Valery Tscheplanowa: "Das Pferd im Brunnen"
Die Sichtachse freiräumen
15. August 2023. Die Schauspielerin Valery Tscheplanowa hat die Gabe, ihren Figuren eine ganz eigene Form der Lebensklugheit zu verleihen. Nun legt sie ihren ersten Roman vor: "Autobiografisch geprägt" ist dieser laut Verlagsankündigung. Eine Spurensuche in der russischen Familie – und eine Menschenerforschung.
Von Christine Wahl
15. August 2023. Unvergessen, wie Valery Tscheplanowa vor sechs Jahren als Gretchen in Frank Castorfs Volksbühnen-"Faust" auf die beiden Jungs herabblickte, die da zu ihren Füßen, mit Tröten im Mund, auf Dreirädern herumfuhren: Faust und Mephisto. Diese Grunderhabenheit, die geradezu aufreizend wirkte in ihrer durch nichts und niemanden zu beirrenden Souveränität, brachte Tscheplanowa damals sehr zu Recht den Titel als "Schauspielerin des Jahres" 2017 ein.
Unterwegs in der Restverwandtschaft
Dieser Tage wurde sie erneut gefeiert, als "Nathan der Weise" bei den Salzburger Festspielen: die Versöhnungsfigur des Dramenkanons, die sich mühelos regelrecht abdichten ließe mit Güte und Vergebungspathos auf der Bühne. Valery Tscheplanowa allerdings – erst kurz vor der Premiere für die erkrankte Kollegin Judith Engel in Ulrich Rasches Lessing-Inszenierung eingesprungen – machte die aufklärerische Stimme der Vernunft zu einem hochkomplexen Ereignis. Deren philosophische Schärfe im gleichen Moment derart zu adeln wie zu erden – und sie ganz nebenbei noch in ein dialektisches Verhältnis zu setzen zu einer lakonischen Lebensklugheit –, das gelingt möglicherweise niemandem so wie ihr.
Jetzt hat die 1980 im russischen – damals sowjetischen – Kasan geborene Schauspielerin ein Buch geschrieben: "Das Pferd im Brunnen", einen "autobiografisch geprägten Roman", wie der Klappentext verrät. Die Ich-Erzählerin Walja, die – wie Tscheplanowa – als Kind mit ihrer Mutter nach Deutschland ausgewandert ist, sucht dort nach den Spuren ihrer russischen Familie in sich. Sie erinnert sich an ihre Urgroßmutter Tanja, mit der sie seligmachende Kindertage in deren ländlichem Holzhaus verbrachte, angefüllt mit langen Gängen zum Wasserholen an einem Brunnen und dem Besuch der Nachbarinnen, die sich direkt bei ihrer Ankunft allesamt bäuchlings auf den Fußboden legen, um sich von dem Kind – Massage in einem Land ohne Massagestudios – weiträumig auf dem Rücken herumspazieren zu lassen. Tanja ist es auch, die Walja heimlich, in einer buchstäblichen Nacht- und Nebelaktion in einer verhangenen Dorfkirche, taufen lässt: Religionsausübung hat im sowjetischen Realsozialismus straftatsbestandsähnlichen Charakter.
 Die zweite Frau, die Tscheplanowa mit scharfer Beobachtungsgabe porträtiert, ist Waljas Großmutter Nina, die Tochter der Urgroßmutter: ein Kriegskind, das schon mit sieben Jahren in einem Lazarett die Fußböden schrubben muss, später als Krankenschwester in einer Psychiatrie so viel Kraft und Geduld für die Patienten aufbraucht, dass für die eigene Familie nicht mehr viel übrigbleibt, und deren resolutes Auftreten die komplette Restverwandtschaft – wie es Walja scheint – grundsätzlich einen Kopf kleiner macht. Als Nina in den 1990er Jahren ihre Tochter Lena, also Waljas Mutter, an einer Bundesstraße in Nordwestdeutschland besucht – im Haus eines gealterten Entertainers namens Horst Karl Johnny, der sein Geld auf Kreuzfahrtschiffen verdient –, lässt sie ungerührt Gebrauchsgegenstände und Dekoartikel mitgehen; sogar vor einem Spielzeug ihrer Enkeltochter schreckt sie nicht zurück.
Die zweite Frau, die Tscheplanowa mit scharfer Beobachtungsgabe porträtiert, ist Waljas Großmutter Nina, die Tochter der Urgroßmutter: ein Kriegskind, das schon mit sieben Jahren in einem Lazarett die Fußböden schrubben muss, später als Krankenschwester in einer Psychiatrie so viel Kraft und Geduld für die Patienten aufbraucht, dass für die eigene Familie nicht mehr viel übrigbleibt, und deren resolutes Auftreten die komplette Restverwandtschaft – wie es Walja scheint – grundsätzlich einen Kopf kleiner macht. Als Nina in den 1990er Jahren ihre Tochter Lena, also Waljas Mutter, an einer Bundesstraße in Nordwestdeutschland besucht – im Haus eines gealterten Entertainers namens Horst Karl Johnny, der sein Geld auf Kreuzfahrtschiffen verdient –, lässt sie ungerührt Gebrauchsgegenstände und Dekoartikel mitgehen; sogar vor einem Spielzeug ihrer Enkeltochter schreckt sie nicht zurück.
Die Art, in der Valery Tscheplanowa all das beschreibt, erinnert stark an ihr Spiel: Die komplexen Porträts, die im Laufe des Romans von Tanja, Nina und – etwas randständiger auch von Lena oder deren Bruder Mischa – entstehen, bestechen durch traumwandlerische Klischeevermeidung. Die Autorin nähert sich ihren Figuren mit einem phänomenologischen Blick, der jedes Detail interessiert zur Kenntnis nimmt, ohne es direkt zu bewerten, und der anschließend dorthin weiterwandert, wo die Phänomene – vielleicht – ihren Ursprung haben.
Es ist eine Vergangenheits- und eine Menschenerforschung im Modus des vorurteilsfreien Fragens, nicht des selbstgewissen Konstatierens, die Tscheplanowa hier unternimmt. Und genau deshalb, weil ihr die Hybris der besserwissenden Nachgeborenen so fern liegt, schafft sie en passant auch etwas, was gerade im Ost-West-Kontext selten gelingt: Sie räumt die Sichtachse wieder frei von vielen Stereotypen, die sich seit dem Ostblock-Zusammenbruch dort aufgebaut und bilateral verfestigt haben. Mit feinem Witz reflektiert Tscheplanowa über Wesen und Wirkung des realsozialistischen Schlangestehens, ohne es zu exotisieren. Mit dem Höchstmaß zärtlicher Urenkelinnen-Liebe schaut sie auf Tanjas sowjetisches Selbstversorgerinnen-Landleben, ohne es zu romantisieren. Und mit entlarvender Schonungslosigkeit lässt sie Horst Karl Johnnys realkapitalistisches Karriere-Elend Revue passieren, ohne es – oder ihn – zu denunzieren.
Biografien, in die Körper eingeschrieben
Phänomenologisch ist Tscheplanowas Blick dabei auch in einem ganz konkreten Sinn: Sie nähert sich ihrem Romanpersonal tatsächlich gern von außen, vom physischen Erscheinungsbild her, an, um sich von dort aus weiter nach innen vorzutasten. Mit dem Instrumentarium der Schauspielerin, so scheint es, entwickelt sie Biografien aus den Spuren, die sich in die Körper eingeschrieben haben und lässt sie aus Haltungen, Bewegungen, Gängen, Gesten in der Beschreibung plastisch werden. Was dabei entsteht, sind nicht zuletzt (Frauen-)Figuren, die in ihrer Originalität und Vielschichtigkeit Seltenheitswert besitzen, in der Literatur wie auf der Bühne. Denn genau wie Tscheplanowas Nathan-Blick auf die Co-Personnage in Rasches Lessing-Inszenierung ist auch Waljas Blick auf ihre Vorfahrinnen ein nachsichtiger. In beiden Fällen handelt es sich um eine Art Zugewandtheit höheren Bewusstseins, die durch mehrere Reflexionsstufen gegangen ist: eine Versöhnlichkeit, die nichts und niemanden idealisiert, die umstandslos auch die weniger vorteilhaften Seiten des Homo Sapiens zur Sprache bringt und seine Härten und Hässlichkeiten keineswegs mildtätig verzeiht, sondern vielmehr stehenlässt – mit der Größe, die sich aus der Kenntnis der Umstände gewinnen lässt. Tanja, die die Radieschen für ihre Urenkelin in zehntelmillimeterdünne Scheiben schneidet, hat ihrer Tochter Nina einst den Weg auf die Musikschule verbaut, weil sie sie – alleinstehend nach dem Krieg – als Arbeitshilfe brauchte. Und auch Nina ist Walja eine liebevollere Großmutter als sie ihren eigenen Kindern eine Mutter war.
Waljas – und mithin Tscheplanowas – Russland ist eines der achtziger, neunziger, nuller und frühen zehner Jahre, mit erzählerischen Ausflügen in die Jugend ihrer Vorfahrinnen. Die russische Gegenwart – Putins Angriffskrieg auf die Ukraine – ist nicht Teil von ihm. Über Ideologien, Geschichte und Systeme erfährt man allerdings, historienübergreifend, sehr viel aus Tscheplanowas Roman. Gerade, weil er genau – und unideologisch – das alltägliche, individuelle Leben in ihnen beschreibt.
Das Pferd im Brunnen
von Valery Tscheplanowa
Rowohlt Berlin, 192 Seiten, 22 Euro
Mehr zu Valery Tscheplanowa: Hier ihre Rede über die Schauspielkunst als Jurorin des Alfred-Kerr-Preis 2022.
mehr bücher
meldungen >
- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater










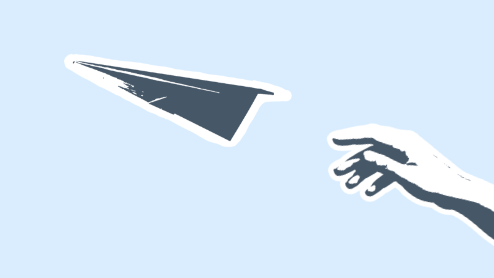
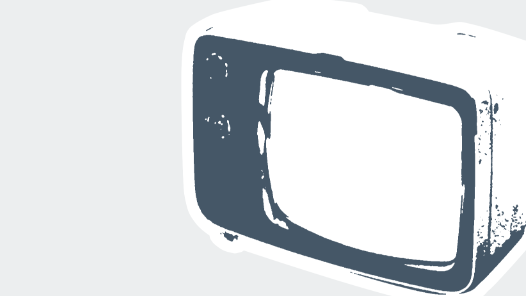
neueste kommentare >