Muttersprache Mameloschn - Maxim Gorki Theater Berlin
Bitch, meine Übermutter!
8. Dezember 2023. Sasha Marianna Salzmanns Stück über drei Generationen jüdischer Frauen in Deutschland "Muttersprache Mameloschn" kam 2012 in Berlin zur Uraufführung und machte dann Karriere. Jetzt kommt es am Gorki in der Regie von Hakan Savaş Mican auf die Bühne. Und liest sich komplett neu.
Von Gabi Hift

Sasha Marianna Salzmanns "Muttersprache Mameloschn" am Gorki Theater Berlin © UteLangkafel / Maifoto
8. Dezember 2023. Mameloschn ist das jiddische Wort für Muttersprache, und jiddisch geht es los: Daniel Kahn sitzt am Klavier und singt von der jiddischen Mame, oder von der verlorenen Heimat, auch der in der DDR, in einer Mischung aus Wehmut und Humor.
Dann geht er nach hinten in die Garderobe – wir sehen ihn auf Video – und erzählt den Schauspielerinnen Witze: "Ein Jude sagt zu seinem Psychiater: Herr Doktor, ich glaube ich hatte einen Freudschen Versprecher." – "Erzählen Sie!" – "Ich will beim Essen zu meiner Mutter sagen: Kannst du mir das Salz geben, bitte?" – "Und, was haben Sie stattdessen gesagt?" – "Mutter, du dreckige Bitch, du hast mein Leben ruiniert." Keine lacht. Ist denn Daniel Kahn der Einzige, der Sinn für jüdischen Humor hat? Wir haben es doch mit lauter jüdischen Figuren zu tun, was stimmt da nicht?
Drei Jüdinnen in Deutschland
Großmutter, Mutter und Tochter, die in Sasha Marianna Salzmanns Stück zusammenwohnen, sind verstrickt in endlosen Schleifen aus Vorwürfen und als Fürsorge getarnten Gemeinheiten. Die drei Frauen sind Jüdinnen in Deutschland und das macht es ihnen fast unmöglich, ihre Konflikte auszutragen, weil sich unter jeder Verletzung ein bodenloser Abgrund öffnet: Lin, die Großmutter, war als junges Mädchen im KZ, hat überlebt, wurde zur begeisterten Kommunistin und Vorzeigejüdin in der DDR. Als Sängerin war sie ständig auf Tournee, durfte auch ins Ausland, aber die Tochter, Clara, hat sie allein gelassen. Die wurde ein todunglückliches Kind, isoliert auch wegen der Privilegien ihrer Mutter und wegen des schwelenden Antisemitismus in der DDR, den ihre Mutter ignoriert.
Clara hasst sowohl den Kommunismus als auch das ganze jüdische Zeug, ist nach der Wende sofort nach Paris abgehauen, aber als sie schwanger wurde, mit Zwillingen, ist sie nach Deutschland zurückgekommen. Sie hat sich an diese Kinder geklammert und das hat sich gerächt. Rahel, die Tochter, will nichts wie weg von zu Hause, nach New York. Das ist doppelt entsetzlich für Clara, weil Rahels Bruder bereits verschwunden ist – und zwar nach Israel, wo er zu einem orthodoxen Juden wurde und den Kontakt zur Familie abgebrochen hat.
 Drei Generationen jüdischer Erfahrung in Deutschland: Alexandra Sinelnikova, Anastasia Gubareva und Ursula Werner spielen "Muttersprache Mameloschn" © Ute Langkafel / Maifoto
Drei Generationen jüdischer Erfahrung in Deutschland: Alexandra Sinelnikova, Anastasia Gubareva und Ursula Werner spielen "Muttersprache Mameloschn" © Ute Langkafel / Maifoto
Hakan Savaş Mican, den eine lange Zusammenarbeit mit Sasha Marianna Salzmann verbindet, inszeniert im Gorki Studio auf einfache und sympathische Art am Text entlang. Die Witze oder Lieder von Daniel Kahn lagern sich von außen an die Geschichte an. Wenn Rahel oder Clara einen Brief, den sie geschrieben haben, sprechen, dann zeigt ein Video im Hintergrund ihre Sehnsuchtsfluchtorte: Bei Clara ist das ein nostalgisches Paris, bei Rahel New York, mal als Utopia aus den siebziger Jahren mit jungen Menschen, die in den Straßen auf den Autodächern tanzen, mal menschenleer und postapokalyptisch.
"Oh, Baby, it's a wild world"
Micans Regie konzentriert sich ganz auf die drei hervorragenden Schauspielerinnen. Alexandra Sinelnikovas Rahel muss sich als Jüngste gegen eine überlebensgroße Großmutter und eine dramatisch leidende Mutter behaupten. Sie spielt das ganz schlicht und unaufgeregt, und obwohl sie kühl bleibt, spürt man ihre unablässige innere Suche nach der Person, die sie einmal sein möchte. Anastasia Gubareva als Clara steckt in der Mitte zwischen beiden Fronten. Verbotene Wut auf die Mutter – auf eine Holocaustüberlebende darf man nicht wütend sein – und Verzweiflung und Angst wegen ihrer Kinder zerreißen sie fast. Dabei klemmt sie in ihrer eigenen Spießigkeit fest wie in einem Käfig. Gegen Ende dreht sie einmal durch und zerlegt die ganze Wohnung. Gubareva bricht dabei in den Song "Oh. baby, baby, it's a wild world" aus und sprengt mit einer phantastischen Musicalperformance für ein paar Minuten jeglichen Rahmen.
Am faszinierendsten ist aber Ursula Werner als Großmutter, die für diese Rolle nach langer Zeit ans Gorki zurückkehrt. Man bewundert ihre Lin restlos für ihren Heldenmut, die nie endende Kraft, mit der sie ihr Leben gemeistert hat – und erschrickt gleichzeitig vor der furchtbaren Verdrängungsleistung, mit der sie es schafft, dass ihr weder die Schrecken des KZs mehr etwas anhaben können noch irgendwelche Selbstzweifel über ihre Rolle in der SED. Ursula Werner gelingt es monströs und grandios zu sein – und dabei auch noch liebenswert. Für diese Leistung wird sie vom Publikum gefeiert.
Die Weltlage macht das Stück neu lesbar
Dieses Stück hat heute eine völlig andere Wirkung als bei seiner Uraufführung am Deutschen Theater Berlin 2012. Das liegt nicht daran, dass Mican irgendetwas am Text verändert hätte, sondern dass es vor dem Hintergrund der heutigen Lage in der Welt ein anderes wird. Damals konnte man den Text so lesen, dass die drei Frauen hauptsächlich miteinander und mit den eigenen inneren Dämonen zu kämpfen hatten. Was sie fesselte, die erdrückende, übermächtige Vergangenheit, zeigte sich ihnen in Gestalt der Mutter, jener "Bitch", die ihr Leben ruinierte. Über diese neurotischen Gestalten konnte man vor zehn Jahren verständnisvoll lachen.
Dieses Stück hat heute eine völlig andere Wirkung als bei seiner Uraufführung am Deutschen Theater Berlin 2012.
Wenn die Mutter heute verrückt vor Angst ist, weil ihr Sohn nach Israel ausgewandert ist und sie keine Nachricht von ihm hat, dann wird man wohl kaum über sie als typisch übervorsichtige jüdische Mutter lachen. Wenn Lin erzählt, dass sie nach der Rettung aus dem KZ sicher war, dass der Marxismus und die Linken sie für immer vor Antisemitismus und Verfolgung schützen würden, dann klingt das heute nicht mehr nur nach einem naiven Fehlurteil über die DDR.
Und wenn sie vom einzigen Mal spricht, als sie sich geweigert hat, die von ihr verlangte Rolle zu erfüllen, erschrickt man: Die SED hatte bei Ausbruch des Jom Kippur Krieges von allen Juden verlangt, Israel als Aggressor zu verurteilen. Aber Lin hat sich geweigert: Die Nachbarstaaten "fallen in ein Land ein, das gerade Tag der Vergebung feiert und schlachten sie alle nieder. Ich wollte nicht gegen das Land aussagen, mit dem ich nichts, rein gar nichts zu tun hatte. Es war weder meins noch nicht meins. Ich fand es einfach nicht richtig."
Diese "Es war weder meins noch nicht meins" macht die ungeheure Schwierigkeit spürbar, zu erklären, was man fühlt – Lin, die sonst alles weiß, kann es sich selbst nicht klarmachen. Das ist wiederum ein großer Moment fürs Theater.
Das Stück wirkt heute bitterer und verzweifelter. Dass die Figuren durch eine ordentliche Psychotherapie aus den Fängen der Vergangenheit befreit werden könnten, kann man nicht mehr glauben. Und dass keine der drei Figuren über die weisen, wehmütigen Witze von Daniel Kahn lachen kann, macht Sinn. Erst im allerletzten Moment entsteht ein kleines, ungeschicktes Bild der Hoffnung: Die Großmutter ist ausgerechnet an Jom Kippur gestorben – nach einem missglückten Versuch, sich mit Clara zu versöhnen. Rahel ist in New York und kann nicht rechtzeitig zur Beerdigung kommen. Aber die drei Schauspielerinnen sitzen doch zusammen zu dritt am Boden und beginnen vorsichtig miteinander zu sprechen. Und nun erzählt Rahel einen Witz und der – toten – Lin entkommt der erste Lacher des Abends, es ist nur ein halber – ein "HA". Mit diesem winzigen Trost endet dann ein bitterer aber wichtiger Abend.
Muttersprache Mameloschn
von Sasha Marianna Salzmann
Regie: Hakan Savaş Mican, Bühne: Alissa Kolbusch, Kostüme: Sylvia Rieger, Musik / Live-Musik: Daniel Kahn, Video: Sebastian Lempe, Dramaturgie: Holger Kuhla, Clara Probst.
Mit: Ursula Werner, Anastasia Gubareva, Alexandra Sinelnikova.
Premiere am 7. Dezember 2023
Dauer: 1 Stunde 25 Minuten, keine Pause
www.gorki.de
Kritikenrundschau
Eine "sehr direkte Spielweise, die sich noch eingrooven wird", erlebte Ulrich Seidler von der Berliner Zeitung (online 8.12.2023) am Gorki Theater. "Die Dialoge von Salzmann – inszeniert von Hakan Savaş Mican, dessen Spezialität behutsam erzählte Lebenswege sind – bestehen aus kurzen, einfachen, für sich genommen fast unschuldigen Sätzen, die mit Kraft und aus tiefer Kenntnis um den anderen auf den Schmerz zielen. Sie schlagen zu, und sie schlagen zurück, Angriff, Abwehrreflex, Gegenangriff. Zugleich ist alles schon dreimal reflektiert, wird auf der Warum-tust-du-mir-das-an-Metaebene ausgefochten. Ideologien, Traditionen, Religionen, Weltkonflikte dienen als Munition. Um die verletzenden Pointen zu setzen, braucht es natürlich eine große Begabung zum Humor."
Salzmanns früher Text haben sich sehr gut gehalten, "was man nicht unbedingt von allzu vielen Stücken der neueren deutschen Gegenwartsdramatik behaupten kann", schreibt Peter Laudenbach in der Süddeutschen Zeitung (9.12.2023). "Mit seiner Klarheit, Intelligenz und Schönheit wirkt das Stück wie die Antwort auf die aktuellen Blähungen eines aggressiven Antisemitismus. (...) War die Uraufführung vor einem Jahrzehnt temporeiches und durchaus pointenorientiertes Wellmadeplay-Theater, ist Micans Inszenierung jetzt deutlich konzentrierter, angesichts der Zeitumstände vielleicht auch bitterer und ratloser."
"Eine große Qualität von Salzmanns Stück liegt darin, dass die Liebe der drei Frauen zueinander die Unmöglichkeit ihres Zusammenseins besiegt", schreibt Sophia Klieeisen in der Morgenpost (9.12.2023). Doch auf der Bühne im Studio verkomme diese Spannung zum Klischee. "Leider misslingt es der Regie von Hakan Savas Mican, die Spielerinnen aus der Typik zu befreien, in die sie auch ihre Kostüme (Sylvia Rieger) bringen. Es gibt weder Zeit noch Raum für das gerichtete Selbstgespräch, immer ist da ein Gegenüber, der singende Pianist als abwesender Bruder-Sohn-Enkel (Daniel Kahn) oder das Publikum als Adressat ihrer Briefe", so Klieeisen. "Im dunklen Abbild der Gegenwart bleibt nur eine Ahnung davon, was vor zehn Jahren gemeint war."
Regisseur Hakan Savaş Mican "verlässt sich ein bisschen zu sehr auf die Geschmeidigkeit von Salzmanns Text und die zündenden Pointen, weshalb die Figuren viel stehen, sich noch mehr anschreien und wenig tun", schreibt Irene Bazinger in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (12.12.2023). Die Rezensentin hebt die Szene hervor, in der sich die Figur Lin an den Jom-Kippur-Krieg erinnert und "wie massiv die offizielle DDR den Staat Israel" ablehnte. "Für die unprätentiöse Inszenierung spricht, dass sie auch hier ihre neutrale Zurückhaltung bewahrt und jede Aktualisierung vermeidet."
Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben
Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.
mehr nachtkritiken
meldungen >
- 27. April 2024 Theater Rudolstadt wird umbenannt
- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio
- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg
- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur
- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz
- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems
- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte
- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater
neueste kommentare >
-
Schiller-Theater Rudolstadt Untote Klassiker around
-
Leser*innenkritik Wüste, DT Berlin
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Bringschuld
-
Schiller-Theater Rudolstadt Don Carlos, der Infanterist
-
Kritik an Thalia Theater Hamburg Versagen der Leitung
-
Asche, München Verpasste Chance
-
Neue Leitung Darmstadt Intuitiv gesprochen
-
Essay Berliner Theaterlandschaft Unbedingtheit und Risiko
-
Pollesch-Feier Volksbühne Angerers Monolog
-
Zusammenstoß, Heidelberg Nicht leicht mit der Avantgarde




















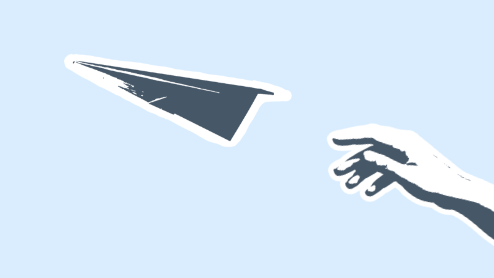
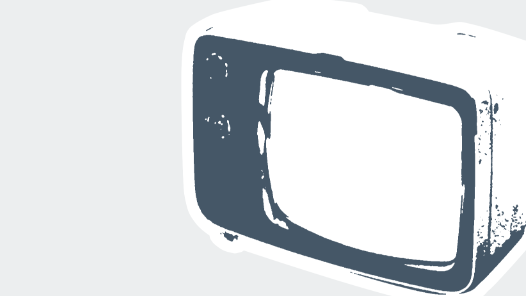
Die drei Frauen-Generationen ringen mit sich und ihrer Identität, können nicht mit-, aber auch nicht ohne einander: eine typische Familie mit zickigen Rededuellen, gegenseitigen Verletzungen und doch immer wieder Aufeinanderzugehen. Die stärksten Momente gehören den beiden erfahreneren Spielerinnen Werner und Gubareva, die sich in diesem intensiven Kammerspiel auf engem Raum abarbeiten.
Der Regisseur unterlegt dies wie so oft durch Live-Musik von David Kahn, der eigene jiddische Lieder komponierte, Lieder von Cat Stevens und Leonard Cohen am Klavier neu interpretiert und vor allem immer wieder jüdische Witze einstreut. Für die Videoaufnahmen aus der New Yorker Eastside, die Rahels Fernweh bebildern, ist Sebastian Lempe zuständig.
Shermin Langhoff und ihr Team haben diese Premiere über jüdische Identität natürlich schon viel länger geplant und sicher nicht hektisch auf Aktualität reagiert. Genau zwei Monate nach den Terror-Anschlägen der Hamas auf Israel bekommen die Passagen, in denen die Figuren über ihre Angst vor Antisemitismus und ihre Sorge um den nach Israel ausgewanderten Bruder zwangsläufig einen zusätzlichen Resonanzboden, ohne dass größere Einschnitte in den ein Jahrzehnt alten Text notwendig sind.
Komplette Kritik: https://daskulturblog.com/2023/12/07/muttersprache-mameloschn-gorki-theater-kritik/